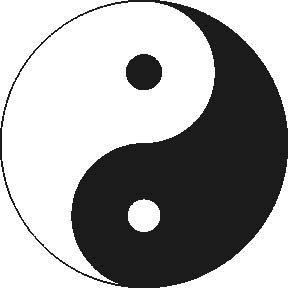
Der Daoismus (im Deutschen auch: Taoismus) ist neben dem Konfuzianismus und dem Buddhismus eine der drei großen chinesischen Lehren und sowohl Philosophie wie auch Religion. C. G. Jung, der inspiriert vom Erfolg von Sigmund Freuds Psychoanalyse seine eigene Schule der „Analytischen Psychologie“ gründet hatte, zog sogar eine Verbindungslinie zwischen Daoismus und Tiefenpsychologie. In diesem Kurs werden sollen sowohl die religiösen, wie auch die historischen, philosophischen und psychologischen Aspekte des Daoismus behandelt werden.
Die Wurzeln des Daoismus
Die historischen Wurzeln sind nicht genau datierbar, ein Anhaltspunkt ist aber das „Daodejing“ des Laozi (Laotse), das im 4. und 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung entstand. In seiner philosophischen Ausprägung ist der Daoismus nicht nur in der chinesischen Oberschicht, sondern auch in der westliche Welt bis heute lebendig. Eine Renaissance erlebte er außerhalb Europas durch das Aufkommen neuer philosophischer und religiöser Bewegungen mit den Studentenbewegung der Sechziger Jahre.
Vom daoistischen Mönchswesen zur Staatsreligion
Der religiöse Daoismus ist in China eine eigenständige Religion, deren Wurzeln weit bis in die vorchristliche Zeit zurückreichen. Sie besitzt eine Vielzahl Göttern und Geistern, ähnlich wie die antiken polytheistischen Religionen des Abendlandes. Mit dem dem 2. Jahrhundert n. Chr. bilden sich feste Kultformen und religiöse Gemeinschaften. Das Leben im alten China ist gefahrvoll, und die gesetzlichen Bestrafungen für alle, die im Verdacht der Untreue gegen den im Geiste des Konfuzianismus regierenden Kaiser stehen, sind furchtbar. Mancher Denker zieht sich in die Bergwelt zurück. Der idealisierte „daoistische Bergmensch“ lebt zu dieser Zeit in der Einsamkeit und ist mit sich und der Natur im Einklang. Doch auch das Leben der Mönchsgemeinschaften entwickelt sich trotz aller Widrigkeiten, ebenso wie im parallel zum Daoismus aufkeimenden Buddhismus. Im 7. Jahrhundert n. Chr. vollzieht die Tang – Dynastie in China einen durchaus ähnlichen Schritt wie der abendländische Kaiser Konstantin zu Beginn des 4. Jahrhunderts. Die vormals unterdrückte Religion wird zur Staatsreligion.
Das Daodejing

Der religiös ausgerichtete Daoismus hat zum Ziel, durch die Meditationsformen Qi Gong 气功, Tai Chi 太极 und einer Reihe von weiteren Ritualen eine Verbindung zwischen dem Universum und dem den einzelnen Menschen herzustellen. Der philosophische Daoismus verfolgt dasselbe Ziel, ist aber weniger von kultischen Handlungen und Zeremonien, sondern eher von einer Geisteshaltung geprägt. Beiden Richtungen gemeinsam gemeinsam ist die Hinwendung zu einer für den Außenstehenden zunächst schwer verständlichen Symbolsprache aus Linien und Kreisen.
Als Begründer des Daosimus gilt Laozi 老子, dessen historische Existenz allerdings nicht wirklich als gesichert gilt. Er soll im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt haben, das in China unter die Epoche der „streitenden Reiche“ fällt. Bedingt durch Unruhen, Aufstände und Kriege gelangte die Herrschaft in die Kries und die Philosophie zur Blüte. Eine Vielzahl von philosophischen Schulen entwickelten Ideen darüber, wie Ordnung, Frieden und Einheit wieder herzustellen seien.
Das Hauptwerk des Daoismus – das Daodejing 道德经 – wendet sich als Ratgeber an einen Herrscher, der Sorge für die richtige Regierung tragen möchte. Es wird zwar Laozi zugeschrieben, ist aber wahrscheinlich erst im 4. Jahrhundert vor Christus aufgezeichnet worden.
Laozis Vermächtnis
Laozis ursprünglicher Name lautet Er Li. Die Legende sagt, dass im Jahr 604 v. Chr. eine Frau im Staat Chu gegen einen Pflaumenbaum gelehnt einen Sohn gebar, der 62 Jahre davor empfangen wurde. Er konnte schon gleich nach seiner Geburt sprechen. Er zeigte auf den Baum und sprach, er würde seinen Namen danach wählen: Li. Sein Vorname Er kommt von seinen großen Ohren, die im alten China ein Zeichen von Weisheit waren. Nach seinem Tod wurde er Dan genannt, was langlappig bedeutet.
Zu den wichtigsten Legenden um die Person Laozi (Laotse) gehört auch der Anstoß zur Niederschrift seiner Gedanken:
Im Alter von 160 Jahren wandte sich der Philosoph vom niedergehenden Zhou – Hof ab und beschloss, eine neue Umgebung aufzusuchen, die für die Entwicklung seiner Gedanken fruchtbarer wäre. Er verließ Zhou westwärts. Ein Grenzbeamter hatte den Weisen schon erwartet und bat ihn innigst, doch seine Gedanken zu hinterlassen. Laozi schrieb für ihn das Daodejing, das „Buch vom Sinn“ und ritt anschließend auf einem Ochsen weiter nach Westen.
Das Daodejing ist das einzige Werk, das Laozi zugeschrieben wird. Es hat einen Umfang von ca. 5000 altchinesischen Schriftzeichen, und ist in kurzen, prägnanten Sätzen und Paragraphen verfasst. Ihre Übersetzung und Deutung stellt bis heute ein große Herausforderung dar.
Das Dao

Der Begriff „Daoismus“ leitet sich von „Dao“ (Tao) ab. Dieses war schon vor dem Daoismus in der chinesischen Philosophie bekannt, rückte aber erst durch das Lehrwerk „Daodejing“ in den Mittelpunkt. Ähnlich wie das altgriechische „Logos“ bietet es eine Fülle von unterschiedlichen Bedeutungen und Interpretationsmöglichkeiten.
Ursprünglich stand „Dao“ wohl für den Begriff „Weg“. Später kamen Deutungen wie Prinzip, Methode und „richtiger Weg“ hinzu. Laozi verwendet Dao auch für eine der Welt zugrundeliegenden, alldurchdringenden Ordnung und Einheit, in der die Gegensätze aufgehoben sind. Dieser unterstehen alle anderen Dinge. Das Dao ist aber nicht definierbar, sondern entzieht sich der genauen Analyse des menschlichen Verstandes.
Yin und Yang
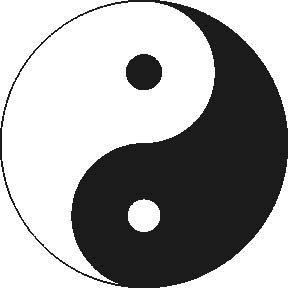
Die im Westen bekanntesten Begriffe des Daoismus sind die Gegensätze Yin und Yang. Yin beschreibt ursprünglich die dunkle, schattige Seite eines Berges, Yang die helle und sonnige. Im Verständnis des Daoismus gibt es auf der Erde und im All nichts, das nicht Yin oder Yang unterworfen ist, auch nicht der Mensch. Das Weibliche steht hierbei für Yin und das Männliche für ist Yang. Yin ist das Passive, Yang das Aktive, Yin die Null und Yang die Eins, Yin das Nichts und Yang das Sein.
Beide Begriffe sind untrennbar miteinander verbunden und dürfen niemals isoliert betrachtet werden. Ähnlich wie bei Heraklit, dem großen vorsokratischen Denker des Abendlandes, ergibt sich die Harmonie der Welt aus dem Zusammenspiel der Gegensätze.
Wu Wei
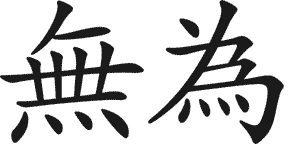
„Wu Wei“ ist der dritte zentrale Begriff des Daoismus. Es bezeichnet die intuitive Weise des „Nicht-Eingreifen“. Da sich die Dinge vom Menschen unbeeinflusst weiterentwickeln, wäre es unvernünftig, sein Schicksal durch allzu bewusstes Handeln beeinflussen zu wollen. Der Mensch kann sich nur intuitiv am Dao orientieren. Die Phänomene sind einem ständigen Wandel unterworfen. Die daoistische Ethik, also das, was das richtige Handeln des Menschen beschreibt, ist daher eine Ethik der Zurückhaltung. „Wu Wei“ bedeutet, mit möglichst wenig Energie die Wandlungen der Welt zu begleiten, sich die Ziele der Natur zu den eigenen zu machen und sich auf keinen Fall gegen sie zu stemmen. Der Weise lässt das „Sein“.
Europas Weg zur Sinologie
In der Neuzeit waren es Jesuiten, die zuerst als Vertreter des Abendlandes mit dem Daoismus in Kontakt traten. Der Austausch fand mit dem Kaiserhof der Mandschu statt. Aus dem Jahr 1788 datiert die erste Übersetzung des Daodejing ins Lateinische, die an die Londoner Royal Society übergeben wurde. Unübersehbar ist dabei die Intention der Übersetzer, Fernöstliches und Christliches miteinander zu verweben und zu harmonisieren.
Einen Boom erlebte die Sinologie in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die ersten Europäer damit begannen, Texte der Daoisten im Original zu studieren. Die erste deutsche Übersetzung (1870) von Lao-Tse verdanken wir Victor von Strauß. Seine Übersetzung ist bis heute (!) von der deutschen wie der chinesischen Fachwelt anerkannt. Ein Philosoph wie Schopenhauer, der fernöstlichen Weisheitslehre zugeneigt, wäre sicher über dieses Werk sehr glücklich gewesen, starb aber schon vor der Veröffentlichung. Die Nachfolger im 20. Jahrhundert, von Heidegger bis Hesse, bedienten sich gerne der Gedanken des Daodejing und empfahlen sie auch als Gegenentwurf zum modernen Europa der Leistung und der Geschwindigkeit. Heute zählt der Daoismus, obschon seine Lehren durchaus lebenspraktisch ausgerichtet sind, zum etablierten Teil der als spirituell bezeichneten Strömungen.
Das Daodejing
Dao, kann es ausgesprochen werden,
Kapitel 1 des Daodejing
Ist nicht das ewige Dao.
Der Name, kann er genannt werden,
Ist nicht der ewige Name.
Das Namenlose ist des Himmels und der Erde Urgrund,
Das Namen-Habende ist aller Wesen Mutter.
Darum:
»Wer stets begierdenlos,
Der schauet seine Geistigkeit,
Wer stets Begierden hat,
Der schauet seine Außenheit«.
Diese Beiden sind desselben Ausgangs
Und verschiedenen Namens,
Zusammen heißen sie tief, des Tiefen abermal Tiefes,
Aller Geistigkeiten Pforte.
Der Daoismus und das Sein
Victor von Strauß, der „erste Sinologe Deutschlands“, zieht einen Interpretationsfaden vom altgriechischen Logos über das chinesische Dao bis zur Sichtweise des Urgrundes beim christlichen Mystiker Meister Eckart.
Am Anfang steht der Grund alles Seins, der auch der Grund aller Erkenntnis und der Lehre ist. Der Name des Grundes ist unbekannt, das Wörtchen Dao also eher ein Platzhalter denn eine klare Definition. Die Anschauung des Dao, des Absoluten, ist eine Perspektive frei von Begierden und frei vom Alltäglichen.
Der Philosoph Zhuangzi
Als der bedeutendste Lehrer des Daoismus gilt der Philosoph Zhuangzi (Schreibweise auch Zhuangzhou), der von ca. 369-286 vor Christus lebte. Er schrieb das Werk „Nanhua zhenjing“ (das wahre Buch vom südlichen Blütenland), das wichtigste Dokument des Daoismus in seiner philosophischen Ausrichtung. Manchmal trägt auch das Buch den Titel des Autors, also ebenfalls „Zhuangzi“.
Das Buch ist aber kein geschlossenes Werk, sondern eher eine Textsammlung. Von den 33 Kapiteln hat Zhuangzi die ersten sieben selbst verfasst. Dabei interpretierte Zhuangzhi die Weisheiten das Daodejing nach seiner Zielsetzung. Er stellt weniger die politischen Aussagen in den Vordergrund, sondern den einzelnen Menschen. Das angestrebte Ideal ist der mit sich in Harmonie lebende, weltabgewandte Weise.
Der Schmetterlingstraum
Eines Tages schlief Zhuangzi. Er träumte er sei ein Schmetterling und flattere durch die Luft. Er fühlte sich glücklich und hatte Zhuangzi nicht in seinem Sinn. Plötzlich erwachte er war wieder wirklich und wahrhaftig Zhuangzi. Nun wusste er nicht: War er nun ein Schmetterling, der träumte er sei Zhuangzi? Oder war er Zhuangzi, der träumte er sei ein Schmetterling? So ist es mit der Wandlung der Dinge.
Streben nach Harmonie
Die Philosophie im alten China legte weniger Wert auf eine formale Logik als die der Griechischen. Sie ist auch nicht so stark metaphysisch verankert wie die indischen Schulen. An der Praxis orientiert, legt sie aus am Alltag ihre Bezugspunkte fest. Ihr Grundzug ist das Streben nach Harmonie, nach einem Mittelweg. Gleichwohl stellt sie sich auch der Frage nach der Erkenntnis überhaupt. Es geht ihr um die Wandlung der Dinge und um die Grenzen des menschlichen Wissens und noch grundlegender die der menschlichen Erkenntnisfähigkeit. Dabei geht es noch nicht einmal um die Welt als Ganzes, sondern um das Selbst, dass wir doch eigentlich kennen müssten. Aber schon an dieser naheliegenden Aufgabe führt uns Zhuangzi vor, mit welch begrenzten Mitteln wir ausgestattet sind.
Der Freiheitsbegriff von Zhuangzi
Der Freiheitsbegriff von Zhuangzi wird in der Geschichte über Liezi, der auf dem Wind reitet, thematisiert:
„Erst nach fünfzehn Tagen kehrte er zurück. Er war vollständig unabhängig vom Streben nach dem Glück; aber obwohl er nicht auf seine Beine angewiesen war, war er noch von Dingen außerhalb seiner Seele abhängig. Wer es aber versteht, sich das das innerste Wesen der Natur anzueignen und sich treiben zu lassen vom Wandel der Urkräfte, um dort zu wandern, wo es keine Grenzen mehr gibt, der ist von keinem Äußeren mehr abhängig“
Die Rezeption von Zhuangzi in Europa
Nur vermeintlich handelt es sich bei der Philosophie Daoismus um ein Denken, das auschließlich im Osten beheimatet ist. Viele abendländische Philosophen und Literaten bedienten sich des asiatischen Mythos‘, drückten aber Gedanken aus, die ebenso in den abendländischen Schulen verwurzelt sind. Beispiele hierfür sind die Philosophischen Schriften und Briefe des römischen Stoikers Seneca ebenso wie Goethes Ausführungen über „die Natur“ und Kafkas Kurzgeschichte „Beim Bau der chinesischen Mauer“.
Traditioneller Daoismus und neuere meditative Elemente

Die philosophischen Schriften des Daodejing des Zhuangzi (gleichnamig mit dem Lehrer Zhuangzi) enthalten keine direkten Hinweise darüber, dass die Einheit des Menschen mit dem Dao über Körperübungen zu erreichen ist. Im Gegenteil, Zhuangzi selbst äußert sich eher belustigt zur Idee, die Kräfte aus dem Körper heraus zu aktivieren, um so das Leben zu verlängern. Die Meditation ist eine Erfindung neuerer Zeit, in der die Lehre von Yin und Yang, die Lehre der fünf Elemente, alte schamanische Traditionen und medizinische Erkenntnisse miteinander verknüpft werden.
Die Pflege des Lebens
Zwar ist es eine daoistische Tugend, sich nicht allzu sehr in den Lauf der Welt einzumischen, doch das Leben selbst darf gepflegt werden. Im Prinzip des Wu Wei geschieht dies mit dem Prinzip der minimalen Kraftanstrengung. Richtschnur ist die Natur, denn auch das Wasser fließt und ändert seinen Charakter auf sanfte Weise. Die Atem- und Körperübungen sind deshalb auf Ausgleich bedacht. Die Meditation braucht eine Umgebung der Stille. Wer sich in dieser Stille fallen lassen kann, braucht keine Netze mehr. Er verwirklicht die Vereinigung von Gegensätzen und ist mit der Welt im Reinen.
Innere und äußere Alchemie
Themengebiete der heutigen daoistische Lebenspraxis:
- Philosophie
- Atemübungen
- Körperübungen
- Stille Meditation
- Ernährungskunde
- (Heil-)Kräuterkunde
- Sexuelle Praktiken
- Schicksalswege
Die innere Alchemie strebt die Umwandlung negativer Emotionen, die Öffnung des Herzens, und die Entwicklung des klaren Bewusstseins an. Sie ist in ein Meditationssystem integriert, das auch Verbindung zum Schamanentum und zu den den tantrischen Schulen des Mahayana-Buddhismus aufweist. Diese buddhistische Schule, im Westen auch als „großes Fahrzeug“ bekannt, gehört zu den drei großen buddhistischen Hauptströmungen. Die innere Alchimie hat zum Ziel, die Yin- und Yang-Energien auszugleichen und das Verhältnis der fünf Elemente, die im Körper den Organen Lunge, Niere, Leber, Herz und Milz entsprechen, in die richtige Balance zu bringen. Die Lunge bietet hierbei den direkten Zugang nach außen, sie nimmt über den Atem die Qi-Kräfte direkt aus den Quellen der Natur. In der Meditation wird das Qi zum Shen, zum Geist, der sich innerhalb des physischen Körpers entwickelt. Die äußere Alchemie beschäftigt sich mit den chemischen Stoffen und deren Veredelungen. Hierbei gibt es Parallelen zur westlichen Heilkräutermedizin.
Literatur: C.G. Jung/R. Wilhelm: Das Geheimnis der Goldenen Blüte. Ein chinesisches Lebensbuch, Olten und Freiburg im Breisgau 1971. Philip Rawson und Laszlo Legeza: Tao. Die Philosophie von Sein und Werden. München, Zürich 1974. Wolfgang Bauer: Geschichte der chinesischen Philosophie, München 2001.
